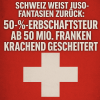Kommentar: Googles Link-Policy ignoriert die ökonomische Realität des Internets – und gefährdet die Vielfalt von Medien, Blogs, Unternehmen und digitalen Märkten
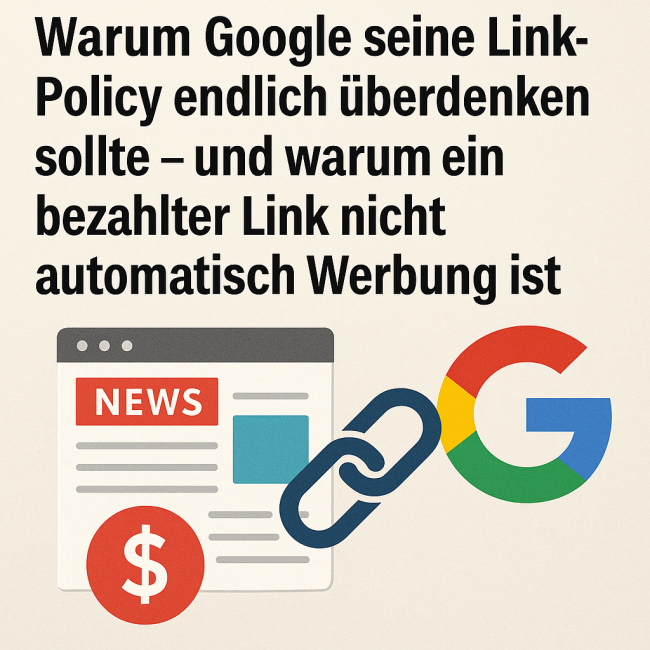
Googles Haltung zum Thema Linkverkauf und sogenannten „manipulativen Backlinks“ ist aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäß. Seit fast zwei Jahrzehnten versucht der Konzern, jede Form der Bezahlung oder Gegenleistung für Links zu unterbinden, um das Ranking „rein“ zu halten. Doch diese Sichtweise ignoriert, wie sich Journalismus, Online-Publishing und digitale Wertschöpfung tatsächlich entwickelt haben. Sie stammt aus einer Zeit, in der wenige große Plattformen das Netz dominierten und die Idee einer offenen, fairen Linkkultur noch lebte. Heute verhindert Googles rigide Policy, dass kleine, unabhängige Anbieter – ob journalistisch oder idealistisch geprägt – ökonomisch überleben können.
Wir bei NETZ-TRENDS.de haben über viele Jahre journalistische Linkarbeit betrieben – und zwar im besten Sinne des Wortes. Wenn wir über andere Themen, Unternehmen oder Personen berichteten und das für relevant hielten, setzten wir oft einen Link – als Quellenangabe und als Service für die Leser. Natürlich sezten wir in dofollow. Wir haben noch nie einen nofollow-Link vergeben, weil wir das komplett für falsch halten. Entweder gebe ich einen Link oder nicht.
Teile und Herrsche muss auch im Netz gelten. Die altrömische Überzeugung. Gib, so wird Dir gegeben. Und dieses Motto galt auch umgekehrt: Wenn Redaktionen unsere Inhalte zitierten und einen Backlink auf unser Portal setzten, geschah das nicht, weil jemand dafür bezahlt hatte, sondern weil die Quelle als relevant oder originär eingestuft wurde. Über die letzten 13 Jahre haben wir unzählige solcher Backlinks kostenlos gesetzt – nicht, um SEO zu betreiben, sondern aus journalistischer Verantwortung und Transparenz. SEO hat uns, um ehrlich zu sein, nie interessiert. Das war vielleicht falsch, aber so war es bei uns.
Diese Praxis war Teil einer journalistischen Grundhaltung: Wer zitiert, sollte auch verlinken. So entstand im besten Fall eine digitale Vertrauenskette – ein Netz aus wechselseitiger Transparenz und Wertschätzung. Doch seit Google begann, Links in technische Kategorien wie „nofollow“, „sponsored“ oder „ugc“ (User Generated Content) zu pressen, ist aus dieser offenen Kultur ein Klima der Unsicherheit geworden, ja bei vielen sogar der Angst. Der Angst vor Vernichtung durch Google.
Googles aktuelles Regelwerk – die sogenannten Search Essentials (früher Webmaster Guidelines) – verpflichtet Redaktionen, Blogger und Website-Betreiber, jeden Link, der bezahlt oder vertraglich vereinbart ist, entsprechend zu kennzeichnen und nicht nur das: ihn auf nofollow zu setzen.
Ein „nofollow“-Link signalisiert Google: „Bitte ignoriere diesen Link bei der Bewertung der Zielseite.“ Ein „follow“-Link gibt Linkpower von der Seite, die ihn setzt, an die andere weiter – bewusst oder unbewusst. Und ein „ugc“-Link (user generated Link) gilt für Inhalte, die von Nutzern gesetzt werden, z. B. in Foren oder Kommentaren.
Was ursprünglich sinnvoll erschien – nämlich Manipulationen und Link-Spam zu verhindern – hat sich längst verselbständigt. Heute trifft dieses System gerade jene, die seriös, kritisch und unabhängig arbeiten. Millionen kleiner Blogs, journalistischer Portale und Fachseiten werden algorithmisch entwertet, obwohl sie weder manipulieren noch Werbung betreiben.
Einleitung – Wenn Regulierung zur Marktverzerrung wird
Googles Link-Policy wirkt inzwischen wie ein regulatorisches Instrument, das die digitale Ökonomie strukturell verzerrt und eine faktische Marktlenkung durch ein privates Unternehmen etabliert. Es fördert die Großen und Monopolisten und zerstört die kleinen und Kleinstanbieter und beraubt es eine ihrer wenigen verbliebenen Chancen der Refinanzierung.
Denn nach wie vor hält Alphabet, die Mutter von Google an dem Grundprinzip fest: Jeder bezahlte oder vertraglich vereinbarte Link muss auf „nofollow“ und als „sponsored“ gekennzeichnet werden und darf keinen positiven Ranking-Effekt entfalten. Was als Schutzmaßnahme gedacht war, trifft heute vor allem kleinere Akteure – während große Marken und Medienhäuser davon kaum betroffen sind.
Sogenannte Hyperlinks, Backlinks, sind im digitalen Raum längst zu einer ökonomischen Währung geworden. Sie schaffen Sichtbarkeit, Reputation und Reichweite. Wer diese digitale Währung entwertet, entzieht denjenigen, die keine gewachsenen Marken oder großen Etats besitzen, die wirtschaftliche Grundlage ihrer Online-Existenz.
Google als globaler Marktregulierer – ohne demokratische Legitimation
Mit einem Suchmaschinenmarktanteil von über 90 Prozent (StatCounter, 2024) agiert Google als de-facto-Regulierer der globalen Informations- und Sichtbarkeitsordnung – ohne parlamentarische Kontrolle, ohne gerichtliche Aufsicht.
Wenn Google festlegt, dass ein „Sponsored Post“, eine „Verlagssonderveröffentlichung“ oder jede andere Form bezahlter Kooperation keinen dofollow-Link enthalten darf, betrifft das längst nicht nur den Journalismus, sondern die gesamte Online-Wirtschaft: Start-ups, E-Commerce-Anbieter, Tourismus-Dienstleister, Fachportale, Blogger, kleine Betriebe.
Für globale Markenportale wie bild.de, focus.de, nytimes.com oder thesun.co.uk hat diese Regelung kaum Relevanz. Ihre Kunden buchen keine Beiträge, um Linkkraft zu erhalten, sondern um Reichweite, Markenimage und mediale Aufmerksamkeit zu erzielen. Ob ein Beitrag dort auf nofollow oder dofollow gesetzt ist, ist ökonomisch belanglos – man möchte nur einen Werbeeffekt, wobei der Werbeeffekt allein durch die bloße Präsenz in einem reichweitenstarken, bekannten Medium entsteht. Deshalb sind Sponsored Posts dort regelmäßig mehr oder weniger im Outfit der sonstigen redaktionellen Berichterstattung.
Für kleine oder spezialisierte Anbieter gilt das Gegenteil: Ihre Reichweite ist zu gering, um einen Werbeeffekt zu erzeugen. Ihre wirtschaftliche Legitimation entsteht fast ausschließlich über den SEO-Wert des Links. Wird dieser technisch neutralisiert, entfällt der einzige ökonomische Grund, warum eine Kooperation überhaupt zustande kommt.
Bezahlte Links, Sponsored Posts und Verlagssonderveröffentlichungen – rechtlich zulässig, aber wirtschaftlich entwertet
Das deutsche Wettbewerbsrecht unterscheidet zwischen Werbung und anderen wirtschaftlichen Kommunikationsformen. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 7 UWG ist Werbung definiert als
„jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu fördern.“
– Quelle: Gesetze-im-Internet.de, vgl. auch EU-Richtlinie 2006/114/EG
Diese Definition enthält zwei entscheidende Komponenten: Zum einen den Absatzförderungszweck, zum anderen das Erfordernis einer „Äußerung“. Eine Äußerung ist – nach ständiger Rechtsprechung – eine kommunikative Handlung, die sich nach außen richtet und regelmäßig eine namentliche oder inhaltlich identifizierbare Bezugnahme auf ein Produkt, eine Marke oder ein Unternehmen voraussetzt.
Fehlt eine solche namentliche Nennung oder identifizierbare Bezugnahme, liegt keine Äußerung im Sinne des § 2 UWG vor – und damit auch keine Werbung.
Gerade im Bereich kleiner und mittlerer Portale werden jedoch häufig Links gesetzt, die weder Produkt noch Unternehmen namentlich erwähnen. Die Verlinkung dient allein der der Weitergabe von Linkpower der eigenen hart aufgebauten Webseite an eine andere. Es geht gerade nicht um eine werblichen Darstellung. Der „Werbeeffekt“ liegt somit doppelt bei null: Es wird kein Produkt genannt und kein Kaufanreiz geschaffen.
In solchen Fällen handelt es sich also nicht um eine „Äußerung zur Absatzförderung“, sondern um eine technische Sichtbarkeitsmaßnahme – eine Form digitaler Infrastrukturleistung, die rechtlich keine Werbung ist.
Damit ist die pauschale Gleichsetzung „bezahlter Link = Werbung“ nicht nur unpräzise, sondern juristisch falsch.
Das strukturelle Paradoxon – Transparenz wird bestraft, Intransparenz belohnt
Googles derzeitige Regelung produziert einen systemischen Widerspruch:
Wer Kooperationen transparent kennzeichnet – etwa mit dem Hinweis „Anzeige“, Verlagssonderveröffentlichung“ oder „Sponsored Post“ und einen Backlink auf dofollow auf einen Kunden setzt – wird algorithmisch benachteiligt. Wer dagegen auf Kennzeichnung verzichtet und gegen die Google-Regeln verstößt, dafür aber den vom Kunden gewünschten dofollow Link setzt, also Seitenpower der eigenen Webseite an den Kunden weitergibt, ist im Graubereich, lebt in ständiger Angst vom Riesen Google entdeckt und eliminiert oder abgestraft zu werden.
Die Folge von Googles Link-Policy ist der digitale Graubereich, in dem Links heimlich verkauft werden, weil die offizielle, rechtskonforme Kennzeichnung ökonomisch unmöglich geworden ist. Kunden stornieren Kooperationen bei kleinen Portalen in der Regel sofort, sobald klar ist, dass ein der integrierte Backlink des Kunden auf nofollow gesetzt werden muss. Der Grund: Der SEO-Effekt entfällt, und der werbliche Effekt ist bei kleinen Reichweiten ohnehin nicht messbar und auch nicht der Grund für einen Kundenauftrag.
Damit hat Google ein System geschaffen, das Transparenz entmutigt und Intransparenz belohnt – ein Zustand, der im Widerspruch zu den eigenen Grundsätzen steht.
Zugleich betreibt Google über Ads und AdSense selbst ein milliardenschweres Geschäftsmodell, das auf bezahlter Sichtbarkeit beruht. Der Konzern monetarisiert exakt jene Praxis, die er anderen Marktteilnehmern untersagt. Juristisch betrachtet ist dies ein Widerspruch zwischen privater Regelsetzung und Wettbewerbsrecht.
Wettbewerbs- und verfassungsrechtliche Konsequenzen
Googles Doppelfunktion als Suchmaschinenbetreiber, Werbeplattform und Regelsetzer ist ein struktureller Interessenkonflikt. Während der Konzern eigene Produkte bevorzugt, werden andere Anbieter durch die Link-Policy in ihrer wirtschaftlichen Betätigung eingeschränkt. Die Europäische Kommission stellte bereits im Fall Google Search (Shopping) 2017 fest, dass eine solche Selbstbevorzugung wettbewerbswidrig ist.
Hinzu kommt der Grundrechtsschutz der Presse- und Meinungsfreiheit beispielsweise in Deutschland nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG. Zur Pressefreiheit gehört demnach nicht nur die inhaltliche Unabhängigkeit, sondern auch die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Grundlage redaktioneller Arbeit. Wenn Google journalistische oder publizistische Anbieter – direkt oder indirekt – daran hindert, durch klar gekennzeichnete Beiträge Einnahmen zu erzielen, ist dies eine mittelbare Beeinträchtigung der publizistischen Vielfalt.
Hinzu kommt, dass Googles eigenes Werbesystem AdSense, einst als demokratisches Refinanzierungsmodell gedacht, für kleine und Kleinst-Publisher kaum noch funktioniert. Ein Portal mit 25.000 bis 45.000 monatlichen Lesern erzielt heute über AdSense nicht einmal zehn Euro im Monat – ein Betrag, der weder Serverkosten noch journalistische Arbeit deckt. Auch NETZ-TRENDS.de gehört zu den Betroffenen: Trotz professioneller und regelmäßiger Inhalte und das seit 2012 und treuer Leserschaft fließen monatlich oft weniger als 10 Euro aus AdSense.
Die strukturelle Schieflage ist offensichtlich: Während große Medienhäuser durch direkte Werbeverträge, SEO-Teams und Markenbekanntheit stabile Umsätze erzielen, sind kleine Anbieter vollständig von Googles Algorithmen abhängig. Wird ihre Sichtbarkeit herabgestuft, sinken nicht nur die möglichen Werbeeinnahmen überproportional, sondern es wird sämtlichen sonstigen Refinanzierungsmöglichkeiten beraubt.
Der EuGH, Rs. C-132/19 – Google LLC v. CNIL** betont**, dass marktbeherrschende Plattformen bei der Steuerung von Informationsflüssen besondere Rücksicht auf Grundrechte nehmen müssen. Die aktuelle Link-Policy steht in offenem Widerspruch zu diesem Grundsatz.
Reformvorschlag – Qualität und Verhältnismäßigkeit
Eine moderne, rechtskonforme Link-Policy müsste den rechtlichen Begriff der Werbung ernst nehmen. Sie sollte differenzieren zwischen werbefördernden Äußerungen und technischen Sichtbarkeitsmechanismen.
Ein Beitrag, der offen als „Anzeige“, „Sponsored Post“ oder „Verlagssonderveröffentlichung“ gekennzeichnet ist, aber keine namentliche Nennung enthält und keinen werblichen Zweck verfolgt, darf nicht wie Werbung behandelt werden. Für solche Fälle sollte Google dofollow-Links zulassen, um eine faire wirtschaftliche Basis zu schaffen und legale Refinanzierung zu ermöglichen.
Googles Ziel darf nicht sein, jede Gegenleistung für Links zu sanktionieren, sondern ausschließlich unlautere Absatz- und Werbeförderung zu unterbinden. Eine Reform, die Transparenz belohnt statt bestraft, wäre nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch im Einklang mit dem Wettbewerbs- und Presse-recht.
Google muss Realität und Recht wieder zusammenführen
Googles Link-Policy mag aus dem Bedürfnis nach algorithmischer Integrität entstanden sein, sie ist aber zu einem Instrument der Marktlenkung geworden. Sie bevorzugt große, markenstarke Akteure, deren Reichweite jede Regelung überstrahlt, und entzieht kleinen Anbietern die ökonomische Grundlage.
Große Medienhäuser verlieren durch nofollow nichts – ihre Markenwirkung trägt den Werbewert allein. Kleine Anbieter hingegen leben von der Sichtbarkeit durch Links; wird diese technisch ausgeschlossen, verlieren sie ihre wirtschaftliche Existenz.
Googles Richtlinie ignoriert damit die rechtliche Unterscheidung zwischen werbefördernder und rein technischer Unterstützung. Ein Link ohne namentliche Nennung ist keine „Äußerung“ im Sinne des UWG – und somit keine Werbung. Wer ihn dennoch pauschal sanktioniert, verletzt die Prinzipien von Fairness, Rechtsklarheit und Meinungsvielfalt. Denn das ist das einzige, was vielen kleinen und Kleinstportalen als Refinanzierungsmöglichkeit bleibt.
Wenn Google seinem eigenen Anspruch, „die Informationen der Welt zu organisieren und allgemein zugänglich zu machen“, gerecht werden will, muss der Konzern seine Link-Policy dringend überarbeiten und anpassen.
Die Krönung der Geschichte ist: Die Kleinen müssen den großen Publishern und Google helfen immer größer zu werden
Das Absurde an diesem System zeigt sich global: Da Google jede Form bezahlter dofollow-Links als Verstoß wertet, sind kleine und mittlere Anbieter gezwungen, solche Links im redaktionellen Kontext zu „verstecken“ – um keinen algorithmischen Verdacht zu erregen. In der Praxis bedeutet das: Ein vergüteter Backlink darf nie allein stehen, sondern wird eingebettet zwischen drei oder vier sogenannten trusted links – Verweisen auf große, „seriöse“ Domains wie Wikipedia, YouTube, CNN, BBC, The Guardian, New York Times oder staatliche und universitäre Websites. Diese Links dienen als SEO-Tarnung – als eine Art digitaler Feigenblattmechanismus –, der Google signalisieren soll: „Dieser Artikel ist vertrauenswürdig.“
Doch die Ironie liegt auf der Hand: Ausgerechnet jene kleinen Publisher, die ohnehin kaum überleben können und für jeden Backlink um Refinanzierung kämpfen müssen, geben in diesem Prozess kostenlose Linkpower an die globalen Monopole ab. Sie stärken damit genau die Plattformen, die ohnehin schon von Millionen organischer dofollow-Backlinks täglich profitieren. Google hat damit ein System geschaffen, das strukturell die Großen immer größer macht und die Kleinen zwingt, in einer rechtlich und moralisch prekären Grauzone zu operieren.
Das ist die vollendete Absurdität der digitalen Ungleichbehandlung: Diejenigen, die um Sichtbarkeit ringen, müssen ihre begrenzte Autorität an die Giganten abtreten – freiwillig, unfreiwillig oder aus purer Notwendigkeit. Ein globaler Mechanismus, der den freien Wettbewerb im Netz ad absurdum führt.
Vorschlag: Ein dreistufiges, differenziertes Link-System
Eine Reform der Google-Policy könnte beiden Seiten gerecht werden – der Integrität des Algorithmus und der wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit redaktioneller Akteure. Ein mögliches Modell:
1. Redaktionell verifizierte Inhalte („Editorial Qualified Links“)
Google könnte ein Zertifizierungssystem schaffen, bei dem registrierte Medienportale oder Fachblogs ihre redaktionelle Unabhängigkeit durch transparente Angaben belegen (z. B. Impressum, Redaktionsteam, redaktionelle Grundsätze). Links in solchen Beiträgen – auch gegen Gegenleistung – dürften PageRank-neutral, aber nicht negativ bewertet werden, sofern sie inhaltlich eingebettet und nachvollziehbar sind.
2. Transparente, deklarierte Partnerschaften („Transparent Partnerships“)
Statt „nofollow“ oder „sponsored“ pauschal zu entwerten, sollte Google die semantische Ebene stärken. Ein deklarierter Hinweis wie „Kooperation mit…“ oder „in Zusammenarbeit mit…“ könnte vom Algorithmus als neutral, nicht als manipulierend gewertet werden, wenn der Artikel inhaltlich eigenständig ist.
3. Inhaltliche Qualität als Kriterium, nicht technische Markierung
Google verfügt über KI-basierte Inhaltsanalyse. Sie kann längst unterscheiden, ob ein Text journalistisch, werblich oder maschinell generiert wurde. Künftig sollte die inhaltliche Qualität über die Linkbewertung entscheiden – nicht allein die Existenz einer Gegenleistung.
Transparenz statt Misstrauen – eine neue Ethik der Verlinkung
Google könnte so das ursprüngliche Prinzip der offenen, auf Vertrauen basierenden Linkkultur wiederbeleben. Eine Reform der Linkbewertung würde verhindern, dass redaktionelle Arbeit kriminalisiert oder ökonomisch bestraft wird. Sie würde Transparenz fördern, statt sie zu unterdrücken.
Darüber hinaus sollte Google seine ökonomische Verantwortung anerkennen: Der Konzern profitiert täglich von Inhalten, die von unabhängigen Autoren und kleinen Redaktionen produziert werden. Ohne diese Inhalte gäbe es keine Suchergebnisse. Die aktuelle Praxis, kleine Publisher durch algorithmische Restriktionen und faktisch wertlose AdSense-Vergütungen in die Unsichtbarkeit zu drängen, steht im Widerspruch zu Googles eigener Mission, „die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zugänglich zu machen“.
Fazit: Zeit für einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Google und den Produzenten von Inhalten
Googles Anti-Spam-Maßnahmen der frühen 2000er waren berechtigt. Doch sie sind zu einem Dogma geworden, das die Realität von 2025 nicht mehr abbildet. Heute gefährden diese Regeln die digitale Pressefreiheit, indem sie wirtschaftliche Abhängigkeit zementieren und legitime journalistische Kooperationen sanktionieren.
Eine moderne, faire Link-Policy müsste daher drei Ziele vereinen:
Integrität der Suchergebnisse,
Transparenz gegenüber Nutzern,
Wirtschaftliche Tragfähigkeit für kleine und unabhängige Anbieter.
Nur wenn Google den Mut hat, seine Policy grundlegend zu reformieren und Vertrauen statt Misstrauen zur Leitidee zu machen, kann das offene Internet überleben – als Raum der Vielfalt, der journalistischen Qualität und der fairen Teilhabe.
Denn ein freies Netz braucht beides: Algorithmische Verantwortung und ökonomische Fairness.
Verweise u.a.
§ 2 Abs. 2 Nr. 7 UWG – Werbung
EU-Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung
Search Engine Land: Google traffic to news publishers steady (2024)
EuGH, Rs. C-132/19 – Google LLC v. CNIL
Europäische Kommission, Verfahren AT.39740 – Google Search (Shopping) 2017