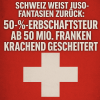Unsichtbar gemacht: Wie Gloria von Thurn und Taxis’ Buch "Lieber unerhört als ungehört" trotz Bestseller-Potenzial versteckt wird bei Thalia in Leipzig
Am 25. September 2025, 20 Uhr, besuchte NETZ-TRENDS.de die Homepage des Langen Müller Verlags in München, also die eigene Webseite des Hauses, welches das neue spannende Buch von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, "Lieber unerhört als ungehört. Lektionen aus meinem Leben" herausgibt. Das Ergebnis: keine einzige veröffentlichte Leserbewertung zu Gloria von Thurn und Taxis’ neuem Buch „Lieber unerhört als ungehört – Lektionen aus meinem Leben“ (ISBN 978-3-7844-3746-0).
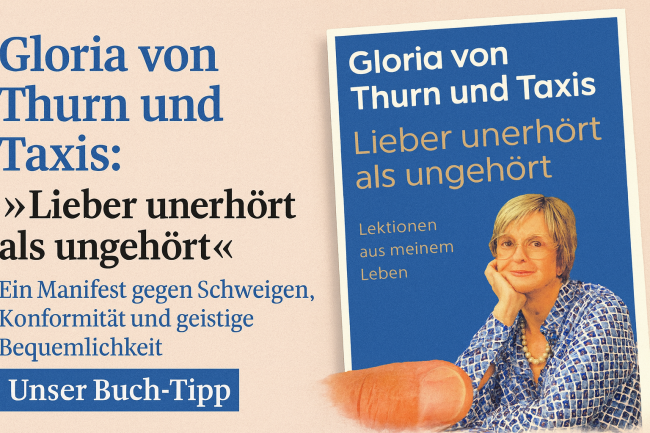
Das Schweigen der Lämmer und Fürstin Gloria von Thurn und Taxis Buch "Lieber unerhört als ungehört. Lektionen aus meinem Leben".
NETZ-TRENDS.de versuchte, sich über langenmueller.de/register anzumelden und eine Rezension zu hinterlassen. Zwar öffnete sich eine Eingabemaske, doch bis heute blieb beim Versuch dort eine Bewertung in Sternchen-Form abzugeben, nichts sichtbar. Ob es am Mozilla-Browser lag oder an einer unglücklich programmierten Verlagsseite, bleibt offen. Fest steht: Wer für eine simple Sterne-Bewertung erst eine aufwendige Registrierung verlangt, legt sich selbst Steine in den Weg – und verzichtet damit auf genau jene, für die Sichtbarkeit im Netz so wichtigen, SEO-relevanten Bewertungen.
Noch ernüchternder war der Befund im stationären Handel. Bei Thalia in Leipzig erblickten wir das Buch auf keinem der Tische im Eingangsbereich, wo Bücher, die das Zeug zum Bestseller haben (wozu man Glorias Buch wohl zählen darf) üblicherweise präsentiert werden. Stattdessen stand es versteckt im Regal des zweiten Stocks, hinten bei den Biografien – unscheinbar zwischen anderen Titeln, kaum auffindbar für ein zufälliges Auge. Drei befragte Buchhändler gaben offen zu, von dem Werk noch nie gehört zu haben. Erst der Blick in den Computer brachte Gewissheit und offenbarte, wie leicht ein prominentes Buch im Handel in Vergessenheit geraten kann. Oh Mann. Wer solche Buchverkäufer hat, ist gestraft.
Zum Glück lässt sich das Buch auch direkt beim traditionsreichen, seit Jahrzehnten hoch angesehenen Verlag Langen Müller online erwerben.
Am Eingang von Thalia in Leipzig wiederum türmten sich ökologische Gesellschaftsspiele – Symbolprodukte ohne die Strahlkraft eines Buches, das eigentlich Debatten anstoßen könnte
So wird ein Werk, das alle Voraussetzungen eines Bestsellers in sich trägt, doppelt unsichtbar gemacht: durch das Bewertungs-Schweigen auf der Verlagshomepage und durch das Versteckspiel im Handel.
Dabei ist Gloria von Thurn und Taxis’ Buch ein Manifest. Schon früh formuliert sie: „Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie nur ein leeres Wort“ (S. 7). Sie geißelt die „Distanzeritis“, also die gesellschaftliche Krankheit, Menschen wegen angeblicher Kontaktschuld auszugrenzen, und fordert Gespräch statt Abgrenzung. Ihre Kapitel zu Familie, Abtreibung, Migration, Eigentum und Kirche sind zugespitzt, kantig und katholisch verankert.
Wenn sie Alice Weidel gegen die angekündigten Attacken von Vicky Leandros verteidigt (S. 6–7), geht es ihr nicht um Parteipolitik, sondern um das Prinzip, dass jeder mit jedem sprechen können sollte. Dass sie im Schlusskapitel den Leandros-Schlager „Ich liebe das Leben“ positiv zitiert (S. 225), zeigt ihre Dialektik: Widerspruch und Anerkennung sind für sie kein Gegensatz.
Immerhin: Auf Instagram läuft derzeit eine professionell inszenierte Social-Media-Kampagne mit der hervorragenden Medienfrau Gloria, der Fürstin, die das Werk modern präsentiert und Reichweite aufbaut. Sie zeigt, wie viel Potenzial in diesem Titel steckt – wenn er denn sichtbar gemacht wird.
Das 239 Seiten umfassende Buch erschien 2025 im Langen Müller Verlag GmbH, München – und schon die äußere Ausstattung zeigt, dass hier Wert auf Sorgfalt gelegt wurde. Die Umschlaggestaltung stammt vom Büro Jorge Schmidt, das Covermotiv von Ilaria Magliocchetti Lombi. Den Satz fertigte Ralf Paucke für den Verlag an, gedruckt und gebunden wurde das Werk bei Friedrich Pustet GmbH & Co. KG in Regensburg. Es handelt sich also um eine in Deutschland produzierte Ausgabe, die nicht auf billigste Weise im Ausland hergestellt wurde, sondern sichtbar auf Qualität setzt. Erhältlich ist das Buch für 24 Euro unter der ISBN 978-3-7844-3746-0.
Die Rezension zum Buch
„Lieber unerhört als ungehört“ provoziert, polarisiert, inspiriert. Es könnte ein Bestseller sein. Doch solange es in Buchhandlungen in hinteren Regalen liegt und die Homepage des Verlags ohne jede Resonanz bleibt, wird es überhört – und das liegt nicht an der Autorin, sondern an einem Markt, der sich selbst blockiert.
Es ist ein Buch, das nicht nur gelesen, sondern durchdacht werden will. Wer es aufschlägt, findet keine seichten Bekenntnisse, sondern eine mit persönlichen Anekdoten, historischen Bezügen und moralischen Appellen angereicherte Streitschrift, die bewusst polarisiert – und gerade dadurch Relevanz gewinnt.
Stil und Aufbau: Klarheit statt Beschwichtigung
Schon der Aufbau des Buches verweigert sich der Konvention. Statt einer klassischen Einleitung steht ein Manifest über die Spaltung der Gesellschaft, statt eines neutralen Schlussworts eine hymnische Feier der Lebensfreude. Diese dramaturgische Klammer verleiht dem Text eine innere Geschlossenheit: Am Anfang steht die Diagnose einer kranken Demokratie, am Ende die Überzeugung, dass Freude, Familie und Glaube stärker sind als ideologische Zwänge.
Die Sprache ist – und das unterscheidet dieses Buch von vielen akademischen Abhandlungen – glasklar, teils bewusst provokant, dabei aber stets in einer Mischung aus aristokratischer Selbstdisziplin und katholischer Verankerung gebändigt. Gloria schreibt nicht als neutrale Chronistin, sondern als streitbare Zeugin ihrer Zeit. Gerade weil sie sich exponiert, entsteht literarische Wucht.
Themenvielfalt: Von der Familie bis zur Globalpolitik
Der Reiz des Buches liegt in seiner thematischen Breite. Die Autorin bewegt sich souverän von der Verteidigung der klassischen Familie über die Kritik an Gender-Ideologien bis zur Analyse der geopolitischen Verwerfungen durch Globalisierung, Migration und Klimapolitik.
Ihre Argumentation ist durchgehend von historischen und persönlichen Bezügen gespeist. Wenn sie den Zerfall der Familie beklagt, verweist sie auf eigene Erfahrungen in Kindheit und Ehe, aber auch auf demografische Statistiken, die den Abwärtstrend belegen. Wenn sie vor einer Gleichmacherei warnt, zitiert sie Kant und verweist auf die französische Revolution als Beginn einer Entwicklung, die nicht nur Befreiung, sondern auch Zerstörung brachte.
Im Kapitel über Migration legt sie die Bruchlinien offen, die seit 2015 durch Deutschland laufen, und stellt Fragen, die in der veröffentlichten Meinung allzu oft ausgeklammert werden. Dabei scheut sie sich nicht, den Blick in die Geschichte zu wagen – bis zurück ins alte Rom, das sie als warnendes Beispiel einer dekadenten, überfremdeten und demografisch geschwächten Gesellschaft deutet.
Ein aristokratischer Blick mit universalem Anspruch
Besonders bemerkenswert ist, dass Gloria von Thurn und Taxis nie rein individuell argumentiert. Ihre Reflexionen sind stets durchzogen von der aristokratischen Sichtweise, dass Herkunft und Verantwortung untrennbar verbunden sind. Der Adel erscheint hier nicht als nostalgisches Relikt, sondern als Bastion von Form, Pflichtgefühl und Kultur, die in einer zunehmend formlosen, nivellierenden Gesellschaft eine Gegenstimme erhebt.
Gleichzeitig zeigt sich in ihrer Haltung eine erstaunliche Universalität. Wenn sie auf ihre Kindheit in Afrika zurückblickt, auf ihre Begegnungen mit Intellektuellen, Künstlern und Politikern, dann ist das keine Flucht in Exotik, sondern der Versuch, die eigene Position durch weltweite Erfahrung zu erden. Ihr aristokratisches Erbe verschränkt sich mit einem kosmopolitischen Blick, der zugleich das Lokale – Regensburg, Schloss St. Emmeram, die Schlossfestspiele – in eine globale Perspektive stellt.
Meinungsfreiheit als roter Faden
Zentral zieht sich durch das Buch ein Plädoyer, das aktueller kaum sein könnte: Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie eine leere Hülle. Dieser Satz ist keine Floskel, sondern die Essenz einer Haltung, die sich gegen Cancel Culture, Kontaktverbote, Sprachregelungen und ideologische Umerziehung richtet. Gloria erinnert daran, dass Demokratie gerade im Streit lebt und dass Vielfalt nicht in künstlicher Gleichmacherei, sondern in der Akzeptanz von Unterschieden besteht.
Die Fürstin insistiert darauf, dass es „Kontakt-Schuld“ nur in Diktaturen gebe. Diese einfache, klare Feststellung ist ein Gegengift gegen eine politische Kultur, die Andersdenkende nicht mehr aushält, sondern stigmatisiert.
Fazit: Ein notwendiges Buch in unruhiger Zeit
Lieber unerhört als ungehört ist mehr als eine Autobiografie und mehr als eine Sammlung konservativer Thesen. Es ist ein intellektueller Stachel, ein bewusst gesetzter Kontrapunkt in einer Gesellschaft, die sich selbst als tolerant versteht, aber immer weniger Stimmen außerhalb des Mainstreams duldet.
Gloria von Thurn und Taxis hat ein Buch geschrieben, das ihre Leser zwingt, Stellung zu beziehen. Wer ihr zustimmt, findet hier eine glänzende, mutige Stimme, die dem Zeitgeist widerspricht. Wer ihr widerspricht, muss sich der Mühe unterziehen, Gegenargumente zu formulieren, statt in Denunziation zu verfallen. In beiden Fällen erfüllt das Buch eine der edelsten Aufgaben von Literatur: Es macht gleichgültiges Wegsehen unmöglich.
Es ist deshalb nicht nur ein persönliches Bekenntnis, sondern ein Werk von gesellschaftlicher Sprengkraft – ein Lobgesang auf Familie, Glaube und Freiheit, aber auch eine Kampfansage gegen Opportunismus und ideologische Gleichschaltung.
Das Glorias Buch in der NETZ-TRENDS-Detail Analyse
Es beginnt mit einem kleinen „Exkurs“ – und einer großen These. In „Reden Sie, mit wem Sie wollen …“ (S. 6–7) legt Gloria von Thurn und Taxis die Grundmelodie ihres Buches fest: Meinungsfreiheit ist die harte Währung der Demokratie, Konversation ihr Zahlungsverkehr. Der Auslöser ist das weithin berichtete Schlossfestspiele-Intermezzo im Juli 2025: Glorias private Einladung an Alice Weidel führt – ihrer Darstellung nach – zu Absagen und Drohungen bis hin zur Sängerin Vicky Leandros, die „zunächst absagen“ wolle und anschließend „schärfste Worte“ gegen den Gast ankündige (S. 6–7, Exkurs, Absätze zur Leandros-Episode). Das Urteil der Autorin ist scharf, der Imperativ glasklar:
„Aber mit diesem unhöflichen, rechthaberischen, die Gesellschaft in moralisch gute und verwerfliche Personen spaltenden Verhalten habe ich ein Problem.“ (S. 7, Exkurs)
„Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie nur ein leeres Wort!“ (S. 7, letzter Satz des Exkurses)
Diese Szene ist nicht bloß Anekdote, sie ist Prisma: Spaltung, Kontaktschuld, Boykottreflexe – Gloria entwirft von hier aus ihr leitendes Motiv: gegen das Moralisieren von Begegnungen, für das Gespräch über Differenzen. Bemerkenswert ist, dass sie Leandros am Ende nicht zur Chiffre ihrer Gegnerschaft versteinern lässt. In „Anstelle eines Schlusswortes: Lebensfreude!“ beschwört sie den bekannten Leandros-Titel – „Ich liebe das Leben“ – als Ausgangspunkt eigener Lebensbejahung (S. 225, Auftaktabsatz): eine rhetorische Volte, die zeigt, wie sie Personen sowohl als Kontrastfolie und als Zitatquelle nutzt.
Ein Buch wie ein Salon: Themenräume statt Chronik
Strukturell ist der Band thematisch gebaut, „Lektionen“ eher als Zirkel, nicht als Lineal. Auf das Vorwort von Martin Mosebach – eine miniaturhafte, verspielte Vignette „Gloria singt“ (S. 8–13) – folgen ein eigenes „Warum dieses Buch?“ (S. 13–14) und die programmatische „Anstelle einer Einleitung: Die gespaltene Gesellschaft“ (S. 15–24). Schon hier zieht Gloria ihre Trenn- und Bruchlinien ein: Ökonomische Schwäche, Bildungsprobleme, „Brandmauer“-Rhetorik und die Erosion gesitteter Streitkultur; sie nennt die „Distanzeritis“ als „Gesellschaftskrankheit“ (S. 7) und argumentiert gegen das politisierte Alltagsklima (S. 15–24). Ihr Stil dabei: zugespitzt, performativ, antikonformistisch – zuweilen kantig, oft kolumnistisch, selten akademisch. Aber gerade diese Physis des Tons macht die Lektüre lebendig.
Herkunft und Verantwortung: Familie, Adel, Formen (S. 25–70)
Der erste große Themenblock beginnt mit „Institution Familie – unter Beschuss!“ (S. 25–38). Gloria verteidigt die traditionelle Familie als „kleinste Zelle der bürgerlichen Gesellschaft“, kritisiert Abwertungstendenzen („entbindende Person“) und identitätspolitische Sprachregime:
„Der Begriff ‚traditionell‘ bedeutet in solchen Zusammenhängen immer etwas Negatives.“ (S. 32–33)
Wichtig ist hier, wie konsequent sie Biografie und These verschränkt: Vertreibungserfahrungen der Eltern (S. 30–31), das eigene Mutter-Ethos und die Dialektik aus Verantwortung und Eigenständigkeit.
In „Der Adel als Bastion der Form“ (S. 39–53) entfaltet sie ihr ästhetisch-sozialgeschichtliches Argument: Adel als Formbewahrer – nicht als Privilegienmaschine, sondern als Traditions- und Stilkompetenz, die man erlernen, pflegen, auch demokratisch wertschätzen könne (S. 42–43). Das ist kulturkonservativ, aber nicht museal; und es arbeitet mit konkreten Wissensbeständen (Stammbaum-, Exil- und Restitutionsgeschichte, S. 44–46).
„Gemeinsamkeit durch Alltagsrituale: Manieren“ (S. 54–62) bündelt das zu einem kleinen Ethikbuch: zehn Prinzipien – Glaube, Liebenswürdigkeit, Ordentlichkeit, Disziplin, Hilfsbereitschaft, ästhetische Erziehung, Friedfertigkeit, Großzügigkeit, Respekt vor Schöpfung und Autoritäten. Der Ton ist altmodisch – und gerade dadurch aktuell, wenn er Zivilität gegen Dauererregung setzt (S. 58–61).
„Die Schlossfestspiele im Wandel“ (S. 63–70) verbindet Gastgeberschaft, Publikum, Boykott-Erfahrungen und die Kunstfreiheit. Auch hier pointiert Gloria das Spannungsfeld Meinung vs. Musik und kritisiert öffentlich moralische Distanzierungen – ein Spiegel ihrer Leandros-Episode (S. 63–70).
Selbstmythos, Selbstkritik: Die „Punk-Prinzessin“ (S. 71–76)
In „Gefeierte Äußerlichkeit: Die Punk-Prinzessin“ ringt Gloria mit der eigenen Medienfigur – pinkfarbene Mähne, Studio-54, Letterman (S. 71–76). Die Pointe: Das „umstritten“ sei nicht die Pose, sondern die Meinung. Die Selbststilisierung dient hier nicht dem Narzissmus, sondern als Folie: Damals wollte die Presse den Exzess; heute irritieren Abweichungen vom Korridor. Diese Selbstanalyse ist – bei aller Pose – die vielleicht reflektierteste Passage des autobiografischen Teils.
Konfliktfelder der Gegenwart (S. 77–160): Abtreibung, Migration, Gender, Rassismus, Nazi-Stigma, Afrika
Der zweite große Block ist das Kontrovers-Kapitelbuch:
„Wo jeder Spaß endet: Abtreibung“ (S. 77–90) – Gloria formuliert ein striktes, religiös fundiertes Lebensschutz-Plädoyer und attackiert euphemistische Sprache („Schwangerschaftsunterbrechung“, S. 79–80). Sie arbeitet mit Bonhoeffer-Zitaten (S. 79–80) und demografischen Argumenten.
„Ein Menschenrecht auf Migration?“ (S. 91–103) – pro Regelung, contra Asyl-Ausweitung zum generellen Zuzug; Glorias Fokus liegt auf Dosis, Kompatibilität, Integration (S. 94–99).
„Diktierte ‚Gleichheit‘: Gender und LGBTQ+“ (S. 102–116) – Kritik an Sprachpolitik (S. 114–116) und staatlicher Symbolpolitik, die aus ihrer Sicht die Ordnung der Dinge politisch normieren wolle.
„Umgekehrter Rassismus“ (S. 117–131) – sie argumentiert gegen Einseitigkeiten im Rassismusthema und belegt an britischen „Grooming-Gangs“ die Blindstellen öffentlicher Wahrnehmung (S. 124–126). Man mag die Auswahl pointiert finden – aber Glorias Belegführung ist eng am Fallbeispiel, nicht nur am Schlagwort.
„Die Stigmatisierung als ‚Nazi‘“ (S. 132–145) – eine Begriffskritik, die die Geschichte ernst nimmt, aber den inflationären Gebrauch geißelt; überdies verweist sie auf konservative Widerstandsfiguren (20. Juli) als Gegenstück zur pauschalen Rechts-Delegitimation (S. 136–141).
„Die einseitige Wahrnehmung Afrikas“ (S. 145–160) – biografisch grundiert (Somalia, Togo; S. 148–150) und kulturkritisch: gegen Monopolerzählungen vom Kolonialismus, für Ambivalenz und Selbstverantwortung (S. 156–160).
Dass man diese Kapitel schwer widerspruchsfrei findet, liegt in der Natur des Gegenstands: Gloria schreibt nicht als Professorin, sondern als Bürgerin, Katholikin, Unternehmerin und Gastgeberin. Wer akademische Sachbuch-Architektur erwartet, verfehlt die Gattung. Hier spricht eine prominente Person, in einer konsequent subjektiven Stimme – und das trägt das Buch literarisch.
Bedingungen der Freiheit (S. 161–212): "Populismus"-Vorwürfe, Eigentum, Ausnahmezustände, Rede
Im dritten Block verschiebt Gloria den Fokus: von Identitätsfragen zu Strukturfragen.
„Der Populismus als Antwort“ (S. 161–174) – eine sozio-politische Skizze: Anywheres vs. Somewheres, Globalismus vs. Nation, Eliten-Disconnect (S. 166–171). Der Essay integriert Medienereignisse (Brexit, „Basket of Deplorables“, S. 168–170) und plädiert – konsequent – für Volksabstimmungen und Selbstbestimmung.
„Eigentum: Bollwerk und Verantwortung“ (S. 175–187) – Glorias eigentliche Kernkompetenz: Verwalten, Sanieren, Ordnen. Die Kapitelpassage zur Erbschaftssteuer, zur Auktion und zur Re-Fokussierung des Hauses Thurn und Taxis (S. 182–185) ist zugleich Selbstporträt und politische These: Eigentum verpflichtet – und schützt Freiheit.
„Dauer-Ausnahmezustände: Corona und Klimawandel“ (S. 188–198) – keine Virologie, sondern Grundrechts-Grammatik: Aus Glorias Sicht geraten Notstandslogiken in ein normatives Dauermodell, das Freiheit konditionalisiert (S. 190–196).
„Keine Vielfalt ohne Meinungsfreiheit“ (S. 199–212) – der kulminierende Essay: Meinung ist der Modus der Demokratie. Die polemische Energetik richtet sich gegen weiche Zensur, Overblocking und das politische Outsourcing von Redegrenzen (S. 206–211). Zentral bleibt: Reden, nicht dosieren – „Reden Sie, mit wem Sie wollen …“ (S. 6–7).
Glaube, Glück, Gloria (S. 213–233)
Der Schluss ist der ernste Gegenakzent: „Glaube: Trost und Zuversicht“ (S. 213–224) und „Lebensfreude!“ (S. 225–233). Wer das Buch bis hierhin als reine Kulturkampf-Prosa einsortiert, erfährt eine Verschiebung der Perspektive: Beichte, Sakramente, Hoffnung – das ist keine Pose, sondern Konstitution ihres Sprechens. Unvergessen, weil schlicht:
„Ich liebe das Leben – so hieß einmal ein Schlager von Vicky Leandros. Wie sollte es auch anders sein? Jeder liebt das Leben, jeder hängt am Leben.“ (S. 225)
Diese Anverwandlung ist programmatisch: Eine Sängerin, deren Handlungsweise Gloria im Exkurs exemplarisch kritisiert (S. 6–7), wird am Ende zur Formel ihrer eigenen Bejahung – und die Fürstin zeigt, dass Widerspruch und Anerkennung koexistieren können. Wer Debattenkultur will, muss auch diese Dialektik aushalten.
Ton, Methode, Ziel
Glorias Prosa ist spitz und sprechend – Kolumnen-Temperament statt Disputationsschrift. Wer evidenzbasierte Monografien sucht, wird an etlichen Stellen Widerspruch anmelden; wer eine markante Stimme hören will, die im deutschen Debattenraum Platz beansprucht, wird sie hier finden. Das Buchanliegen ist durchsichtig und – in sich – konsequent:
Widerspruch wagen: „Sagen Sie Ihre Meinung – und akzeptieren Sie die andere Meinung Ihres Gegenübers.“ (S. 7)
Gespräch statt Kontaktschuld: „Kontaktschuld gibt es nur in Diktaturen.“ (S. 7)
Formen bewahren, Freiheit schützen: Manieren (S. 54–62), Eigentum (S. 175–187), Rede (S. 199–212).
Dass sie dabei zuweilen übers Ziel hinaus schießt (z. B. in Überdehnungen politischer Analogien), gehört zu ihrer Methode – die bewusste Zuspitzung als Stachel. Glorias „Lektionen“ sind kein Seminarplan; sie sind Salonprotokoll, Streitbekenntnis, Glaubenszeugnis.
Fazit
„Lieber unerhört als ungehört“ ist ein Debattenbuch von einer der bekanntesten Prominenten im deutschsprachigen Raum – Deutschland, Österreich, Schweiz –, das sich nicht dem kleinsten gemeinsamen Nenner unterwirft. Es fordert heraus, weil es konsequent spricht, wo sonst dosiert wird; es irritiert, weil es Tradition gegen Zeitgeisttempomat setzt; es überzeugt dort am stärksten, wo die Fürstin biografische Autorität mit formaler Klarheit verbindet (Familie, Formen, Eigentum, Rede).
Wer nur eine Attacke auf Vicky Leandros erwartet, wird überrascht: Leandros ist Einstieg und Motto. Die eigentliche Gegenspielerin ist die Beliebigkeit – und der eigentliche Schutzraum die Freiheit des Wortes.
Präzise Belegstellen (Auswahl)
Exkurs „Reden Sie, mit wem Sie wollen …“: Leandros-Episode und Appell gegen Kontaktschuld, „Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie nur ein leeres Wort!“ (S. 6–7, Schlussabsatz).
„Anstelle eines Schlusswortes: Lebensfreude!“: „Ich liebe das Leben – so hieß einmal ein Schlager von Vicky Leandros …“ (S. 225, erster Absatz).
„Anstelle einer Einleitung: Die gespaltene Gesellschaft“: Analyse der Spaltung, Medienbeispiele, „Brandmauer“ (S. 15–24; v. a. S. 18–21).
„Institution Familie – unter Beschuss!“: Verteidigung der traditionellen Familie und Sprachkritik („entbindende Person“) (S. 25–38; v. a. S. 31–36).
„Der Adel als Bastion der Form“: Adel als Formtradition, Restitutions-/Enteignungsfragen, politischer Kontext (S. 39–53; v. a. S. 42–47).
„Gemeinsamkeit durch Alltagsrituale: Manieren“: Zehn Prinzipien bürgerlicher Zivilität (S. 54–62; v. a. S. 58–61).
„Die Schlossfestspiele im Wandel“: Kunst, Protest, Boykottlogik (S. 63–70).
„Gefeierte Äußerlichkeit: Die Punk-Prinzessin“: Selbstinszenierung und Medienkritik (S. 71–76).
„Wo jeder Spaß endet: Abtreibung“ (S. 77–90); „Ein Menschenrecht auf Migration?“ (S. 91–103); „Diktierte ‚Gleichheit‘: Gender und LGBTQ+“ (S. 102–116); „Umgekehrter Rassismus“ (S. 117–131); „Die Stigmatisierung als ‚Nazi‘“ (S. 132–145); „Die einseitige Wahrnehmung Afrikas“ (S. 145–160).
„Der Populismus als Antwort“ (S. 161–174); „Eigentum: Bollwerk und Verantwortung“ (S. 175–187); „Dauer-Ausnahmezustände: Corona und Klimawandel“ (S. 188–198); „Keine Vielfalt ohne Meinungsfreiheit“ (S. 199–212); „Glaube: Trost und Zuversicht“ (S. 213–224).
Alle Seiten- und Kapitelnachweise beziehen sich auf die vom Nutzer bereitgestellte Ausgabe: Gloria von Thurn und Taxis, „Lieber unerhört als ungehört. Lektionen aus meinem Leben“, LMV/Langen Müller, München 2025, ISBN 978-3-7844-3746-0. Zitate im Wortlaut mit Seitenangabe (S. x). Bei nicht numerierbaren Absätzen ist die genaue Stelle über Kapitel- und Seitenangabe eindeutig auffindbar.