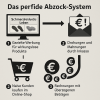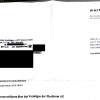Anne Wojcicki: Aufstieg, Täuschung und Fall von 23andMe und die fragwürdige Rolle von Richard Branson
Der Moralischer Offenbarungseid der Anne Wojcicki und ihre fragwürdige Geschichte von 23andMe - Kommentar

Von Anfang an war die Geschichte von 23andMe, dem Gentechnik-Startup aus dem Silicon Valley, ein Beispiel für das, was passiert, wenn PR-Fantasien, Börsengier und persönliche Netzwerke auf ein Geschäftsmodell treffen, das nie wirklich tragfähig war.
Gegründet wurde das Unternehmen 2006 von Anne Wojcicki gemeinsam mit Linda Avey und Paul Cusenza. Bis 2015 war sie Ehefrau des Google-Mitgründers Sergey Brin. Der Name des Unternehmens "23andMe" bezieht sich auf die 23 Chromosomenpaare eines Menschen.
Anne Wojcicki ließ sich rasch als Leitfigur der Genomics-Revolution feiern, als den Star der feministischen Gender-Bewegung. Die mediale Begleitmusik: innovativ, weiblich, verheiratet mit Google-Mitgründer Sergey Brin. In Wirklichkeit jedoch war vieles in diesem Narrativ von Anfang an Blendwerk. Investoren wurden mit vollmundigen Wachstumsprognosen geködert, der Börsengang 2021 via SPAC (Special Purpose Acquisition Company) euphorisch gefeiert – und die Bewertung schoss auf 6 Milliarden Dollar hoch.
Wojcicki war zu diesem Zeitpunkt längst zur Projektionsfläche eines selbstgebastelten Mythos geworden: Tech-Pionierin, Powerfrau, Retterin der personalisierten Medizin. Doch die Realität war ernüchternd: Umsätze stagnierten, Datenschutzskandale erschütterten das Vertrauen, das Geschäftsmodell war weder nachhaltig noch diversifiziert. Und während Kritiker längst warnten, dass 23andMe auf tönernen Füßen stehe, schob Wojcicki weiter PR-Ballons in die Höhe – mit Wachstumsversprechen, die sich im Nachhinein wie bewusste Irreführung lesen.
Jetzt, im Jahr 2025, ist der Niedergang komplett: 23andMe ist insolvent, der Börsenwert liegt bei nur noch rund 17 bis 25 Millionen Dollar. Und was tut Wojcicki? Sie tritt zurück – aber nicht etwa aus Reue oder Verantwortungsbewusstsein. Nein, sie versucht nun, die Konkursmasse günstig zurückzukaufen, um damit einen Neustart zu wagen – diesmal auf dem Rücken der Gläubiger, womöglich auch der Steuerzahler. Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren – ein Prinzip, das in der Finanzkrise 2008 den Banken galt, wird hier zur Blaupause für ein moralisch bankrottes Unternehmertum.
Ohrfeige für jeden Unternehmer
Dass sie dabei erneut auf ihr mediales Image als „Ex-Frau von“ und „Vorzeigegründerin“ setzt, ist nicht nur unverschämt, sondern eine Ohrfeige für jede ehrliche Unternehmerin oder Unternehmer, die oder der ohne Millionennetzwerke und PR-Inszenierung täglich um Kunden, Finanzierung und Vertrauen kämpft.
Wojcicki gehört zu den toxischsten Symbolfiguren des Silicon Valley: Ihre Geschichte ist keine von Scheitern im Sinne von „aus Fehlern lernen“, sondern von kalkulierter Irreführung, Verantwortungslosigkeit und moralischer Kälte. Dass Plattformen wie Perplexity.ai daraus nun - mehr dazu weiter unten - eine Art Gender-Märchen mit Heiligenschein konstruieren, ist eine intellektuelle wie journalistische Bankrotterklärung zumindest von dieser sonst so guten KI. Die Fakten werden verbogen, um ein Narrativ zu retten, das längst kollabiert ist. Nämlich das Narrativ von der angeblich so wenig geförderten Frau im Unternehmertum und ihrer angeblichen eigentlichen Überlegenheit als Start-Up-Gründerin. Die Fakten sprechen seit Jahren eine andere Sprache.
Es geht hier nicht darum, ob Gründerinnen benachteiligt sind – sie sind es häufig, keine Frage. Aber es geht darum, dass auch eine Frau scheitern kann – und zwar aus den falschen Gründen. Anne Wojcicki hat nicht wegen struktureller Benachteiligung Schiffbruch erlitten, sondern weil sie ein Produkt überbewertet, Investoren getäuscht und ethische Prinzipien über Bord geworfen hat.
Das sollte man klar benennen – und nicht als Nebensatz relativieren.
Rücktritt zur rechten Zeit - oder zu spät?
Der Rücktritt von Anne Wojcicki am 24. März 2025, zeitgleich mit der Anmeldung der Insolvenz nach Chapter 11, wirft nicht nur ein schiefes Licht auf das Timing – sondern auch auf mögliche strategische Beweggründe, die weit über das übliche Narrativ des "Abschieds in schwierigen Zeiten" hinausgehen. Denn Wojcicki erklärte offen, dass sie sich damit in eine bessere Position für eine mögliche Übernahme des Unternehmens bringen wolle . Das lässt nur einen Schluss zu: Sie plant den Rückkauf – zu Schleuderpreisen. Ausgerechnet jener Person, welche das Unternehmen mit maximalem Medien-Hype an die Börse geführt, dann aber systematisch heruntergewirtschaftet hat, soll nun das Tafelsilber aus der Konkursmasse zufallen, nachdem sie zuvor Investoren und Kunden mit vollmundigen Zukunftsversprechen an die Wand gefahren hatte.
Dabei war 23andMe kein kleines Start-up – es war ein Projekt mit enormem Vorschussvertrauen: Google, GlaxoSmithKline, Sequoia Capital, Johnson & Johnson und andere sollen gemeinsam über eine Milliarde US-Dollar in das Unternehmen gepumpt haben. Wojcicki ließ sich feiern trotz Datenlecks, FDA-Rückschläge, schrumpfende Nachfrage, Entlassungen, einer katastrophale Aktienperformance.
Und jetzt? Der Rücktritt war kein Schuldeingeständnis, sondern Teil eines Plans. Noch 2024 versuchte Wojcicki, 23andMe für 40 Cent pro Aktie zu übernehmen – ein skandalös niedriger Preis, der vom Sonderausschuss abgelehnt wurde. Auch ein zweiter Versuch im März 2025 scheiterte. Sie bleibt dennoch im Verwaltungsrat – und ist weiter entschlossen, das Unternehmen zurückzukaufen.
Was hier passiert, ist kein tragisches Scheitern, sondern eine kalte Strategie: Die Verluste werden sozialisiert – das, was an verwertbaren Resten bleibt, soll privatisiert werden. Anne Wojcicki inszeniert sich öffentlich als verantwortungsbewusste Gründerin, doch in Wahrheit betreibt sie ein Spiel, das in seiner moralischen Unverfrorenheit kaum zu überbieten ist: Erst Milliardenkapital aus der Tech-Elite einsammeln, dann das Unternehmen ruinieren – und am Ende die Reste selbst wieder einsammeln. Das ist kein Comeback. Das ist Berechnung.
Statt Verantwortung, dubiose Manöver am Kapitalmarkt
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser Rücktritt nicht Ausdruck von Verantwortungsübernahme ist, sondern ein Manöver, um sich elegant aus der Schusslinie zu bringen – gerade noch rechtzeitig, bevor formell der Vorwurf der Insolvenzverschleppung greifbar wird. Denn dass 23andMe bereits seit Monaten am Abgrund taumelte, war in der Szene kein Geheimnis. Statt rechtzeitig die Reißleine zu ziehen, wurde weiter der Schein gewahrt – mit großspurigen PR-Offensiven, während im Inneren längst die Lichter flackerten.
Und Wojcicki selbst? Finanziell ist sie ohnehin längst über den Berg. Der Börsengang von 23andMe machte sie – trotz aller späteren Kursverluste – multimillionenschwer. Denn als Mitgründerin und Großaktionärin war sie in der Lage, beim Höhenflug der Aktie (es wurden gerne Behauptungen eines angeblichen Börsenwerts von 6 Milliarden Dollar verbreitet) erhebliche Summen zu realisieren. Jetzt, da der Wert des Unternehmens bei mickrigen 17 bis 25 Millionen Dollar liegt, will sie offenbar erneut zuschlagen – als hätte es nie einen Vertrauensbruch gegenüber Kunden, Anlegern und der Öffentlichkeit gegeben.
In Summe drängt sich der Verdacht auf: Das war nie bloß unternehmerisches Scheitern – das war ein strategisch orchestrierter Macht- und Reputationszyklus, bei dem Verluste auf die Allgemeinheit abgewälzt und Chancen privat gesichert wurden. Wer das „Comeback“ von Anne Wojcicki nun als Empowerment-Geschichte verkaufen will, sollte sich fragen, wie viel kalkulierte Rücksichtslosigkeit man bereit ist, in ein solches Narrativ zu integrieren.
Ein echtes Vorbild? Ganz sicher nicht.
Eher ein Fall für die nächste Diskussion über Ethik, Macht und Verantwortung im Silicon Valley.
Perplexity.ai: Wenn Gender-PR zur Realitätsverweigerung wird
Geradezu abstrus wird es, wenn man sich die Antwort von Perplexity.ai auf die einfache Frage ansieht: „Schreibe eine kritische Abhandlung zum Konkurs von 23andMe und zur Rolle von Anne Wojcicki“. Heraus kommt keine kritische Analyse, sondern ein ideologisch aufgeladener Text, der mit selektiv ausgewählten Statistiken und feministisch überhöhten Erfolgsmythen jongliert – und dabei das eigentliche Thema, nämlich die unternehmerische Verantwortung und das systematische Scheitern von Wojcicki, fast vollständig ausklammert.
Perplexity zitiert u. a. folgende Zahlen:
„Startups mit weiblichen Gründern oder Co-Gründern übertreffen rein männliche Gründerteams um 63 % bei VC-Investitionen“ (3)
„Für jeden investierten Dollar erwirtschaften Startups mit mindestens einer Gründerin 78 Cent Umsatz, verglichen mit 31 Cent bei rein männlich geführten Startups“ (3)
Diese Zahlen stammen von einer Plattform namens femaleinvest.com, deren erklärtes Ziel es ist, Frauen zum Investieren zu ermutigen – was absolut legitim ist, aber die zitierte Zahl ist methodisch weder nachvollziehbar noch in seriöser Primärforschung fundiert. Der Kontext der Studie bleibt unklar, die Kausalität unbelegt, der Vergleich verzerrt.
Ebenso wird behauptet:
„Nur 2 % des Risikokapitals in den USA gehen an Unternehmen mit ausschließlich weiblichen Gründern“ (1)
Diese Zahl ist zwar häufig zitiert, geht jedoch auf eine schmale Datenbasis zurück und wird in der Debatte oft nicht durch harte ökonomische Realität, sondern durch einseitige Genderpolitik verstärkt. Dass der Zugang zu Kapital komplex ist und u. a. an Netzwerken, Branchenstruktur und Skalierbarkeit hängt, wird ignoriert. Und gerade Wojcicki selbst war das exakte Gegenbeispiel: Sie hatte Zugang zu Kapital, zu Netzwerken, zu Medien – und hat es dennoch verspielt.
Der Perplexity-Text gipfelt in folgendem absurden Satz:
„Die Statistiken zeigen, dass weibliche Gründerinnen oft überdurchschnittliche Leistungen erbringen.“ (3, 5)
Ohne Kontext, ohne empirische Grundlage, ohne Vergleichsgruppen – aber mit maximalem Selbstbewusstsein wird aus einer ideologischen These eine vermeintliche „statistische Tatsache“.
Der eigentliche Skandal dabei: Die Insolvenz eines milliardenschweren Unternehmens, begleitet von Datenschutzskandalen, Investoren-Täuschung und einem CEO-Rücktritt mit potenziell strategischer Absicht, wird in den Hintergrund gedrängt, um ein ideologisch aufgeladenes Gleichstellungsmärchen zu erzählen, das mit der Realität von 23andMe nichts mehr zu tun hat.
Das ist nicht Analyse. Das ist PR. Und das ist gefährlich.
Perplexity: Gründung, Sitz, Investoren wie Amazon-Jeff Bezos und Partnerschaften mit der Deutschen Telekom AG
Die Suchmaschine Perplexity wurde im August 2022 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Gegründet wurde das Unternehmen von Aravind Srinivas (CEO, zuvor bei OpenAI, Google und DeepMind), Andy Konwinski (Präsident, zuvor Mitgründer von Databricks), Denis Yarats (CTO, ehemaliger KI-Forscher bei Meta) sowie Johnny Ho (CSO, vormals bei Quora).
Zu den bedeutendsten Investoren gehört Jeff Bezos, Gründer von Amazon und einer der reichsten Menschen der Welt, der über seinen Investmentarm Bezos Expeditions regelmäßig in Zukunftstechnologien und KI-Unternehmen investiert. Ebenfalls beteiligt ist Nvidia, der weltweite Marktführer für Grafikprozessoren (GPUs), der durch seine zentrale Rolle im KI-Boom bereits bei zahlreichen Technologieunternehmen wie OpenAI, Runway oder Recursion engagiert ist. Ein weiterer Investor ist B Capital, eine von Facebook-Mitgründer Eduardo Saverin mitgegründete Investmentgesellschaft, die sich auf wachstumsstarke Unternehmen in den Bereichen KI, Finanztechnologie und Gesundheitswesen spezialisiert hat.
Darüber hinaus verfolgt Perplexity eine internationale Kooperationsstrategie, unter anderem mit der Deutschen Telekom AG, um die Verbreitung der Suchmaschine im europäischen Raum voranzutreiben und technologische Synergien zu erschließen.
Milliardenfantasie statt Realität: Wie 23andMe mit Richard Branson zur PR-Blase wurde
Besonders irritierend bleibt die Frage, wie realistisch die angeblichen Milliardenbewertungen von 23andMe Holding Co. (vollständiger Name: 23andMe Holding Company) je waren. Während der offizielle Börsengang am 17. Juni 2021 über eine SPAC-Fusion mit VG Acquisition Corp., dem Börsenvehikel des britischen Unternehmers Sir Richard Branson, eine Bewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar festlegte, wurde in Medien und PR-Narrativen bald eine „Bewertung“ von bis zu 6 Milliarden Dollar verbreitet. Diese höhere Zahl stützte sich jedoch nicht auf reale Ertragskennzahlen, sondern auf vage Zukunftsversprechen, Hoffnungen auf neue Medikamentenentwicklungen und ein überhitztes Narrativ von der „Revolutionierung der personalisierten Medizin“.
Dabei sammelte 23andMe beim Börsengang immerhin 592 Millionen US-Dollar an frischem Kapital ein, um laut eigenen Aussagen das Wachstum im Bereich Konsumgenetik und Therapeutika voranzutreiben. Für 2000 Mitarbeiter benötigt man zumindest in Deutschland im Jahr zwischen 80 und 140 Millionen Euro. Das Gehaltsniveau in den USA ist nicht überall deutlich höher, nur in bestimmten Segmenten. Da fragt man sich: Wo ist das Geld geblieben?
Gerade mal 300 bis 500 Mitarbeiter - wo ist das Geld geblieben?
Basierend auf den aktuellsten verfügbaren Informationen hatte 23andMe im November 2024 insgesamt 200 Angestellte entlassen, dies seien, so hieß es damals rund 40 Prozent der gesamten Belegschaft. Dies deutet darauf hin, dass 23andMe vor diesen Entlassungen ungefähr 500 Mitarbeiter hatte. Nach den Entlassungen verblieben demnach etwa 300 Mitarbeiter im Unternehmen. 2018 sollen gerade einmal 229 Mitarbeiter an Bord gewesen sein. Da fragt man sich: Wie kann eine solche Minifirma so viel Geld verbrennen? Wer hat sich hier die Taschen vollgestopft und der Vorwurf des Verdachts eines möglichen Anlegerbetrugs liegt auf der Hand.
Die Kommunikation war euphorisch: Anne Wojcicki versprach, „Gesundheit neu zu denken“ – Branson selbst sprach davon, dass 23andMe das Potenzial habe, das Gesundheitswesen grundlegend zu verändern. Auch personell wurde PR-wirksam aufgerüstet: Neben Wojcicki zogen mit Evan Lovell (Virgin Group) und Peter Taylor (ECMC Foundation) zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat ein – beides Männer mit Finanz- und Hochschulhintergrund, aber keine medizinischen Innovatoren.
Heute, am 26. März 2025, 8:00 Uhr MEZ, ist davon nicht viel übrig: Die Marktkapitalisierung liegt bei nur noch rund 17 Millionen US-Dollar, die Aktie (Ticker: ME) ist de facto zu einem Pennystock verkommen. Das Unternehmen, das einst als Speerspitze der DNA-basierten Gesundheitswende galt, steht kurz vor der Zerschlagung – und Gründerin Anne Wojcicki versucht nun, die Reste aus der Konkursmasse günstig zurückzukaufen, nachdem sie sich mit dem Börsengang finanziell längst saniert hat.
Der Deal mit Branson war damit – aus heutiger Sicht – weniger eine Gesundheitsvision als ein spektakulärer PR-Exit, der unter dem Deckmantel disruptiver Innovation einen Börsenhype produzierte, von dem vor allem das Management und frühe Investoren profitierten. Für Kleinanleger hingegen war es ein kapitaler Fehlschlag. Die Diskrepanz zwischen medial erzeugtem Glanz und realwirtschaftlichem Totalschaden ist nicht nur ernüchternd – sie ist ein Paradebeispiel für systemische Irreführung durch Glamour, Promi-Kapital und Pseudoinnovation.
Absurditäten in der NZZ
Noch im Jahr 2022 war sich die Journalistin Marie-Astrid Langer von der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) nicht zu schade, den bereits damals bröckelnden Hype um die Familie Wojcicki weiter hochzujubeln. Unter der Schlagzeile „Google startete in Susans Garage – diese drei Schwestern prägen das Silicon Valley“ schrieb sie: „YouTube-CEO, Biotech-Gründerin und Ärztin – die Wojcickis gelten in Amerikas Technologie-Mekka als Erfolgsfamilie. Sie glauben, das habe mit ihrer Erziehung zu tun.“
Dabei gab es schon zu diesem Zeitpunkt erhebliche Zweifel am Geschäftsmodell von 23andMe – etwa in Bezug auf Datenschutz, Marktreife und überzogene Umsatzprognosen. Kritische Stimmen warnten früh vor der Überbewertung und der instabilen ökonomischen Basis des Unternehmens. Langer jedoch ignorierte diese Hinweise und entschied sich, eine PR-Legende weiterzuschreiben, die weniger mit journalistischer Distanz als mit affirmativer Bewunderung zu tun hatte – auf Kosten jener, die später auf das „Wojcicki-Versprechen“ hereinfielen.